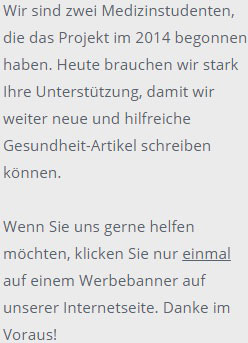Die Wohnsituation – Begutachtungsverfahren der Pflegeversicherung
Die Antwort auf diesen Fragepunkt stellt eine der langlebigsten im Gutachten dar. Noch Jahre nach der Begutachtung schauen Sachbearbeiter gerne unter diesem Punkt nach, wie denn die Wohnsituation des Versicherten ist. Nämlich immer dann, wenn eine Leistung beantragt wird, bei der das Wohnumfeld wichtig ist. Daher wird hier detailliert beschrieben. Dazu zählen alle Hilfen zur Mobilität, vom Badewannenlifter über einen WC-Stuhl oder einen Treppenlift bis hin zum Antrag auf den völligen Umbau eines Bades oder eines anderen Raumes zum Badezimmer. Unter diesem Punkt werden im Wesentlichen folgende Fragen abgearbeitet:
Erreichbarkeit der Wohnung:
In welchem Stock liegt die Wohnung des Versicherten? Wie viele Stufen sind es bis zur Haustür? Gibt es einen Fahrstuhl? All das liegt in der Frage begründet, ob der Versicherte zum Verlassen der Wohnung Hilfe benötigt, nämlich dann, wenn er sehr schlecht oder gar nicht Treppen steigen kann.
Hindernisse innerhalb der Wohnung:
Jede Wohnung sieht anders aus. In Eigenheimen entspricht es meist dem Standard, dass sich Bad und Wohnbereich auf zwei verschiedenen Stockwerken befinden. Das Beschreiben der „inneren“ Hindernisse ist deshalb wichtig, weil Hilfe beim Überwinden der Treppe angerechnet werden muss, wenn es durch pflegerische Maßnahmen am Versicherten notwendig ist. Ist das einzige WC nur über eine Treppe vom Wohn- oder Essraum aus zu erreichen, der Versicherte gleichzeitig unfähig, diese Treppe allein zu bewältigen, dann ergibt sich aus der speziellen baulichen Situation ein Hilfebedarf.
Ganz ähnlich verhält es sich mit anderen ungewöhnlichen Hindernissen. Zum Beispiel kann ein nicht dem Standard entsprechender, schmaler Türrahmen zum WC einen Hilfebedarf notwendig machen, wenn sich der Versicherte nur im Rollstuhl fortbewegen kann und dieser für die Türöffnung zu breit ist. Oder er passt gerade so durch, aber der Versicherte, der sonst den Rollstuhl selbst vorantreiben kann, bringt die Hände nicht zwischen Rad und Tür. In dieser Weise lassen sich eine ganze Reihe von Hindernissen oder Barrieren beschreiben, die später für die Bemessung der Pflegebedürftigkeit wichtig sein können.
Heizung:
Wenn der Versicherte über eine durch Thermostatventile gesteuerte Zentralheizung verfügt, wird er hier Hilfe nur benötigen, wenn er das Bett nicht mehr verlassen kann. Oftmals begegnen den Gutachtern aber auch veraltete oder ganz und gar abstruse Varianten der Heiztechnik. Hin und wieder sind Heizventile in Bodennähe an die Heizkörper angeflanscht, was sich für Versicherte, die sich nicht bücken können, ziemlich übel auswirkt. Gar nicht selten findet man aber auch Einzelöfen, die mit Holz oder Öl betrieben werden, also im Betrieb sehr aufwändig sind. Wenn durch eine Heizung Hilfebedarf entsteht, so zählt dieser immer zur hauswirtschaftlichen Versorgung.
Sanitäre Anlagen:
Sie sind der Dreh- und Angelpunkt im Rahmen dieses Unterpunktes. Für nichts geben die Versicherungen mehr Geld bei den Hilfsmitteln aus als für Hilfebedarf innerhalb
der sanitären Anlagen (fallen darunter doch so arbeitsintensive Tätigkeiten wie Waschen und WC-Gänge, off auch das Kleiden) und für Hilfsmittel für die Nutzung der sanitären Anlagen. Von daher wird im Gutachten sehr genau beschrieben, wie es im Bad aussieht, ob die Bewegungsfreiheit von Patienten und Betreuern dort gewährleistet ist und welche Hindernisse womöglich einer guten Hilfe und Betreuung entgegenstehen. Die Hindernisse werden dabei schon in Bezug auf mögliche Hilfsmittel gebracht; zum Beispiel wird eine drangvolle Enge, in der sich das WC zwischen Heizkörper und Badewanne befindet, bereits mit der Beobachtung verbunden, dass eine Sitzerhöhung für dieses WC nicht angebracht werden kann, weil es dafür nicht genügend Platz gibt.
Gleichzeitig wird der Gutachter auch festhalten, wenn bestimmte Hilfsmittel notwendig sein sollten, mit denen die Hilfe für den Versicherten den Hilfspersonen leichter fällt, oder Anteile der Hilfsleistungen hierdurch entfallen. Klassisches Beispiel ist hier der Haltegriff am WC, durch den der Versicherte aufstehen kann, ohne eine Hilfsperson bemühen zu müssen.